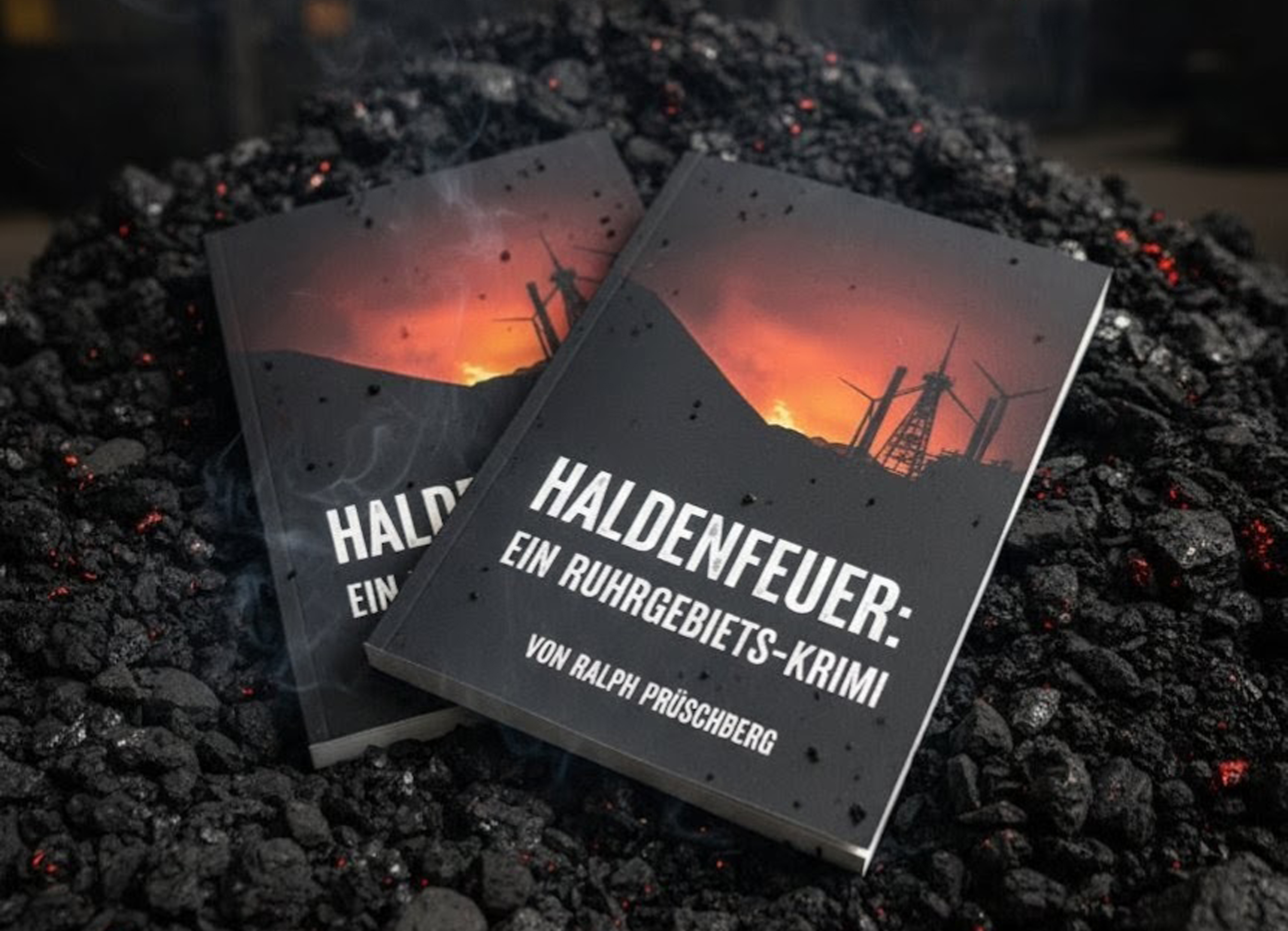Hallo zusammen,
aufgrund meines neuen kleinen Restaurierungsprojekts kamen mir ein paar Gedanken auf. Vielleicht hat ja jemand Lust, sich einzuklinken und seine Meinung zu äußern.
Eine Restaurierung ist ja definitionsgemäß eine Wiederherstellung zum Ursprünglichen. Im Folgenden beziehe ich mich auf antike Möbel und hier auf hölzerne Stücke.
Nach diesem Wortlaut würde das meinem Verständnis nach bedeuten, dass man hierfür die Oberfläche quasi grundsätzlich komplett entfernen müsste. Denn egal ob Schellack, Wachs oder Öl- keine Oberfläche trotzt der Alterung. Im Endeffekt erhalten wir also eine verschmutzte / verstaubte, vom Licht oft vergilbte Oberfläche. Unterschiedliche Umweltbedingungen führen ggf. zu Rissen und Versprödungen.
Es gibt Restauratoren, die am Schluss ein Möbel abliefern, das nach getaner Arbeit „fast wie neu“ aussieht. Und es gibt Restauratoren, die der Meinung sind, einen schlechten Job gemacht zu haben, wenn das Möbel nach getaner Arbeit „fast wie neu“ aussieht. Auch bei Beschlägen ist es ähnlich (ich persönlich mag keine entpatinierten Beschläge, Schloesser, Schlüssel und Scharniere).
Es gibt hier offenbar unterschiedliche Ansätze. Der eine nimmt die Oberfläche vollständig ab, schleift leicht an und erhält eine recht frische Oberfläche. Der andere entfernt die alte Oberfläche von Schmutz und poliert über. Und der Purist entfernt nur den gröbsten Schmutz und Staub. Ich habe viele Varianten gesehen (natürlich gibt es hier viele Möglichkeiten die zwischen den genannten liegen).
Wenn wir beim Holz bleiben, verändert sich natürlich die Struktur über die Jahre. Es wird trockener, härter und dunkelt nach / hellt auf (je nach Holzart) und verändert auch den Farbton.
Nach meinem Verständnis ist die Patina also das Zusammenspiel aus der veränderten Grundsubstanz und der Veränderung der aufgetragenen Oberfläche.
Daher meine Frage: Wo fängt Patina an und wo hört sie auf? Ist die schonende Entfernung von Staub, Dreck, Fett u.Ä. bereits ein Eingriff in die Patina?
ich restauriere aktuell eine kleine Schatulle. Deckel und Boden sind aus jeweils einem massiven Palisanderbrettchen und die Seitenteile vermutlich aus Zebrano. Als ich sie bekam, sah sie eigentlich schon recht gut aus. Lediglich ein wenig Schmutz und eine leicht abgenutzte und stumpfe Schellackoberflaeche war vorhanden.
Der honigfarbene Ton, also die Patina, gefiel mir sehr gut. Also habe ich die alte Oberfläche auf Hochglanz ueberpoliert.
Obwohl die Oberfläche schön homogen, glatt und spiegelnd war (ich habe leider kein Foto gemacht), war das Holz, vor allem die Intarsien, noch immer etwas stumpf. Bei perfektem Lichteinfall konnte man den Glanz des Palisanders und die schöne Riegelung des Zebranos erkennen. Das Überpolieren hat hier nicht sinnvoll gebracht, wie erhofft.
Also habe ich nach reiflicher Überlegung den alten Lack abgenommen. Und siehe da: unter einer einfach zu entfernenden Schicht aus Schellack war eine andere, wachsartige Substanz. Entweder wurde mit Wachs grundiert, oder man verwendete stark wachshaltigen Schellack (falls jemand eine Vermutung hat, gerne her damit). Das Wachs habe ich nicht abgeschliffen oder mit Lösungsmittel entfernt, sondern wenig invasiv mit den Fingern abgerubbelt.
Plötzlich strahlte das gute Stück und die Intarsien wirkten selbst ohne Politur schon viel plastischer. Auch der Glanz der Maserung war viel intensiver.
Anbei ein Vergleichsbild vorher->nachher (mit einer Porenfuellung)
M.M.n war das natürlich ein Eingriff in die Patina und manch einer findet den „alten Look“ besser.
Ich würde es definitiv wieder tun. Auch der Erschaffer der Kiste würde sicherlich das jetzige Erscheinungsbild bevorzugen.
Der honigfarbene Ton ist geblieben, ich bin nicht einmal mit dem Schleifvlies drüber.
Was sagt Ihr dazu?
liebe Grüße und einen schönen Abend;)

- 2B2AF0CC-DECE-47F6-9DE1-3FFC0A932089.jpeg (264.33 KiB) 2709 mal betrachtet

- 4E3B522D-365C-4F5D-869D-88796D6AC82B.jpeg (521.79 KiB) 2709 mal betrachtet